von Eva Busch
Ein Rückblick auf das Symposium Auf die Bühne neue Schwesterlichkeit in Wuppertal, 04.11.2016
Im Anschluss des Rückblicks befindet sich ein kleines Interview mit dem Ismigone Komplex.
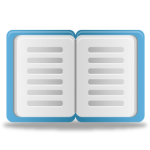
Vier Masterstudentinnen interessieren sich für Feminismus, gründen ein Kollektiv, entwickeln gemeinsame Gedanken und entscheiden sich, ein wissenschaftliches Symposium auf die Beine zu stellen, um die eigenen Fragen mit renommierten Akademiker*innen und Kommiliton*innen zu diskutieren. An dieser Stelle bereits: Chapeau! Den Weg in die Realität finden solche Geschichten doch eher selten. Wohl aber kürzlich in Wuppertal.
Die Vier nennen ihr Kollektiv Ismigone Komplex und stellen Fragen nach zeitgenössischer feministischer Solidarität. “Wir möchten auf die Suche gehen nach Ansätzen und Möglichkeiten der feministischen Theorie, in denen eine Konzeption von Kollektivität und Solidarität auffindbar ist, die die Singularität nicht negiert“, heißt es im Einladungstext zu dem Symposium. Dies in die Frage „Wie können wir solidarischer sein?“ zu übersetzen, würde dabei bereits an der Unklarheit des Wir scheitern. So geht es um die nun offensichtliche Unmöglichkeit, ein „Wir Frauen“ zu formulieren, wie es größere Teile vergangener Generationen von Feminist*innen noch unbefangener taten. In Auseinandersetzung mit Differenz solle versucht werden, „etwas wie Solidarität wieder in die feministischen Scheinwerfer der individualistischen Bühnen des 21. Jahrhunderts zu bringen.“ Wer Solidarität mit „etwas wie“ einleitet und „wieder“ sucht, verweist auf ein Ideal, das in der Vergangenheit vermutet wird. Der Begriff der Schwesterlichkeit, der mich zunächst an inzwischen historische Debatten um eine „global sisterhood“ erinnert, wird vorgeschlagen, um sich diesem Ideal zu nähern und es zu aktualisieren. So fragen sie nach der Möglichkeit für „ein politisch motiviertes Re-Enactment […] Vielleicht, wird es ja bald (wieder) möglich sein, ein gemeinsames Stück zu schreiben und aufzuführen …“
Mit Erfahrungen von feministischem Individualismus und Kollektivität im Schlepptau, angesprochen von dem postkolonialen Schwerpunkt der Veranstaltung und Vorfreude auf die eingeladenen Rednerinnen lande ich am Freitag, 4.11.2016 auf dem Symposium Auf die Bühne neue Schwesterlichkeit. Die Veranstalterinnen sind Studierende des Masters Erziehungswissenschaft: Bildungstheorie und Gesellschaftsanalyse an der Bergischen Universität Wuppertal. Der Namen Ismigone Komplex ist bereits ein Hinweis auf ihre Beschäftigungen mit dem Konzept der Schwesterlichkeit. Denn Ismene und Antigone als zwei grundverschiedene Schwestern werden hier vereint.
Die einführenden Worte der Veranstalterinnen fächern ihre Perspektive weiter auf. Sie betonen, dass wir uns mit einem Feminismus zu beschäftigen haben, der viel zu oft eine Wahlverwandtschaft mit dem Neoliberalismus eingegangen sei. Was es brauche, sei ein Feminismus, der sich post-neoliberal versteht, um der unsolidarisch scheinenden Realität des 21. Jahrhunderts etwas entgegenzusetzen. Das Unsolidarische hängt dabei mit individualistischen, immer wieder dekonstruierbaren Subjektkonstitutionen zusammen, die das späte 20. und frühe 21. Jahrhundert so sehr prägen und von ökonomischen Fragen nicht zu trennen sind. Zentral sollte also die Frage nach Differenz angesichts der Krise der Repräsentation sein, in der das Allgemeine verlorengegangen sei, da es nicht mehr denk- und repräsentierbar ist. Der Tagesplan sieht hierfür zwei Abschnitte mit je zwei längeren Vorträgen, einer Kommentatorin und einer kurzen Diskussion vor.
Die erste Referentin Barbara Rendtorff beschäftigte sich mit der Frage, was feministische Solidarität heute heißen könnte/sollte. Sie betonte ihre Begeisterung für das studentische Engagement und die Dringlichkeit der Frage, gleichzeitig aber auch ihre Skepsis gegenüber dem vorgeschlagenen begrifflichen Rahmen. Die „Schwesterlichkeit“ habe sie zunächst abgeschreckt, aufgrund einer analytischen Unschärfe, sowie historischen Vorbelastung, sodass sie die Einladung zuerst nicht annehmen wollte. Worauf ein längerer E-Mail Austausch folgte, an den sich nun doch dieser Vortrag anschließt. Ihre grundlegende Kritik hier differenziert vorzutragen solle zeigen, dass sie die Studierenden und ihr Anliegen ernst nehme und die Notwendigkeit der Frage sehe:
Rendtorff weist zunächst darauf hin, dass dem Begriff Schwesterlichkeit neben biologischen Assoziationen und der Debatte um sisterhood eine moralisch-emotionale Kontextualisierung anhaftet. Wer ihn heute in eine online-Suchmaschine eingibt, lande zunächst auf Seiten von Sekten, im christlichen Kontext, wo damit meist Vorstellungen von Harmonie verbunden sind.
Wird Schwesterlichkeit als Gegenbegriff zur Brüderlichkeit verstanden, so kann darunter verstanden werden, dass Frauen auch in die (in der Französichen Revolution erkämpften) fraternité aufgenommen werden möchten, was jedoch die Möglichkeiten radikaler feministischer Kritik verspiele. Mit Zygmunt Bauman und Agnes Heller argumentiert Rendtorff, Solidarität beschreibe eine Verantwortung der*s Einzelnen, woraus Verbindungen entstehen können. Dies braucht keine Gleichartigkeit; sie vorauszusetzen, wäre fatal. Solidarität brauche vielmehr eine Entscheidung zur Anerkennung der Andersheit der*s Anderen, die Einsicht in eine Ungerechtigkeit und den Antrieb zum Handeln.
Dem stellt sie das Kollektiv gegenüber. In den 1970ern, der Zeit der aktivistischen Erfahrungen Barbara Rendtorffs, war der Kollektivgedanke stark. Etwa im Rahmen der Frauen-Uni in Berlin, einem Großprojekt, das über Jahre hinweg mehrere Tausend Personen mobilisierte und eine enorme Handlungsfähigkeit genoss. Kollektive wie diese lebten von einem emotionalen Überschuss, der sich jedoch nicht künstlich erzeugen lasse. „Wir hatten es leicht in den 70ern!“, schließt sie daraus, die Stimmung sei eben so gewesen.
Denken im identitär begründeten Kollektiv könne jedoch dazu verleiten, sich dahinter zu verstecken, sei eine Entlastung der eigenen Verantwortung und grenze andere aus. Fragen nach Herausforderungen aufgrund von Diversität innerhalb feministischer Strömungen sind nicht neu. In den 1970er Jahren wurde die US-amerikanische Debatte, in der es insbesondere um die Position Schwarzer Frauen in dem vermeintlich universellen Projekt Feminismus auf der Suche nach einer Schwesternschaft ging, auch in Deutschland rezipiert und diskutiert[1]. Die Kritik war vor allem, weiße Frauen sähen „den Vorteil“ ihrer weißen Haut nicht. Damals wie heute war ein Problem, Differenz nicht ausreichend theoretisch fassen zu können, doch sei klar, dass Differenz nicht mit dem Mantel des Feminismus überdeckt werden dürfe. Insbesondere die Frage nach weiß-westlicher feministischer Solidarität mit Anderen sei problematisch, da sie erneut kollektiviert und meint, etwas zu geben zu haben.
Für feministische Solidarität lasse sich so festhalten, dass sie auf Ungerechtigkeit im Rahmen der jeweiligen Geschlechterordnung reagiere. Es gibt kein darüber hinausreichendes gemeinsam-feministisches Anliegen. Was es jedoch gibt, ist die Möglichkeit solidarischen Handelns, jeweils spezifisch und nicht dem eigenen Nutzen dienend, in jeweils partikularen Handlungen/Aktionen und in Respekt vor den Handlungen anderer (ob sie uns gefallen oder nicht). Solidarität habe man mit Zielen, die man evtl. nicht absolut teile, deren Absicht man aber unterstütze.
„Wir bringen einander gegenseitig in die Bredouille“, begann Elisabeth Schäfer ihren Vortrag, in dem sie den Begriff der Schwesterlichkeit weitestgehend aussparte, sich jedoch lustvoll den Gedankenwelten der Dekonstruktion widmete. Sie diskutierte die im Einladungstext gestellte Frage, ob wir gemeinsam ein neues Stück aufführen könnten, das ihr gut gefalle, da darin ein utopisches Moment stecke. Mit der écriture feminine und dem Verweis auf Hélène Cixous versuchte sie deutlich zu machen, dass möglicherweise ein feministisches Sprechen auch ein weibliches Schreiben oder eine vielsprachige Sprache bedingen könnte. Was könne es heißen und wie überhaupt könnte ein gemeinsames Stück geschrieben werden? Wo führen wir es auf? An welchem Ort, in welcher Institution, mit welchen Ritualen?
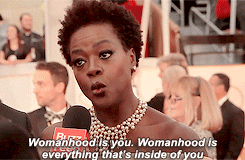
Als theoretische Begrifflichkeit schlug sie vor, Solidarität über die Figur des Mit-Seins zu denken, da mit Jean-Luc Nancy menschliches Sein nur als Miteinander gedacht werden könne. Es gebe keinen Sinn, außer den der Zirkulation. Eine Hinwendung zu den Anderen ist demnach Grundvoraussetzung menschlichen Seins und in dieser Abstraktheit eine mögliche Formel für solidarisches Handeln.
Ebenfalls verweist die Referentin auf Jacques Derrida und dessen Gedanken zur Unterschrift. In welchem Namen können wir unterschreiben? Was stellt diese Unterschrift dar/her? Um unterschreiben zu können, so Derrida, müsse er sich einer Figur des „als ob“ bedienen, das immer nur einem Teil seiner Selbst entspreche, denn wir können nur partikular signieren. Wenn wir unterschreiben, unseren Namen unter etwas setzen, sind wir plötzlich eine Figur, nehmen sie an, unterschreiben als diese Figur des „als ob“, niemals aber mit unserer Person als ganzer. Für Fragen feministischer Solidarität, insbesondere im Kontext von Zusammenschlüssen zu größeren Bündnissen für spezifische Anliegen, wie sie in den vergangenen Jahren im deutschsprachigen Kontext immer wieder gefordert und hinterfragt wurden, kann dies ein interessantes Bild sein. Es zeigt, dass eine Unterschrift, eine Solidaritätsbekundung, immer ein ganzes „Ja“ zu einer Angelegenheit bedeutet, dennoch aber nicht die unterschreibende Person als Ganzes definiert.
Dieses erste Panel, bestehend aus Versuchen, aus einem kritischen Herantasten an die Begriffe der Schwesterlichkeit und (feministischer) Solidarität, erlebten viele Gäste als dicht und anspruchsvoll. Es bereitete Fragen vor, deren Dringlichkeit spürbar war, deren Beantwortung uns noch bevorstand. Insbesondere das Verhältnis von Kollektiv und Solidarität als zwei grundverschiedenen Konzepten, die einander dennoch hervorbringen können, blieb über das Mittagessen hinaus Thema.
Hierauf folgte ein zweites Panel. Diesmal mit konkreten Beispielen feministischer Analysen, die, marxistischer und postkolonialer Theorie folgend, Formen geschlechtsbasierter Ungleichheit betrachten und auf (Un-)Möglichkeiten solidarischen Handelns hinweisen.
Sara Farris sprach über ihre Gedanken zum Konzept des „Femonationalismus“, das sie in den vergangenen Jahren wesentlich prägte. Sie beschreibt damit einen historisch gewachsenen, aktuell immer stärker auftretenden Zusammenschluss nationalistischer, neoliberaler und vermeintlich feministischer Anliegen, wenn im Namen der Rechte von Frauen anti-muslimische Diskurse stark werden. „Der Islam“ werde dabei als Hauptfeind von Geschlechtergerechtigkeit inszeniert, mit der Sharia als größter Gefahr. Autor*innen wie Saba Mahmood haben darauf hingewiesen, dass etwa in Ägypten die Sharia-Gesetzgebung erst im Zuge britischer Kolonialherrschaft institutionalisiert wurde, ähnlich ist es vielerorts mit der Kriminalisierung von Homosexualität gewesen. Dennoch beobachte Farris in Europa eine grundlegende Einigkeit darüber, dass westliche Frauenrechte die hochwertigsten sind; gepaart mit der Idee individueller Verantwortung von Migrant*innen. Sie betont die Notwendigkeit, diese Tendenzen und Ereignisse nicht allein als Populismus abzutun. Vielmehr schlägt sie eine Analyse vor, die ideologische Formationen am Werk sieht, die einer nationalistischen und ökonomisch-neoliberalen Logik folgen. Während der migrantische Mann in Europa als Gefährdung der eigenen gesellschaftlichen Position (des Arbeitsplatztes) erscheint, wird die migrantische Frau immer wieder als schützenswertes Opfer inszeniert. Die Logik ist, dass sie diejenige ist, die beständig zu großen Teilen den Care-Sektor mit billiger Arbeitskraft abdeckt. Damit mache sie nicht zuletzt den gesellschaftlichen Aufstieg bürgerlicher Frauen in Deutschland überhaupt erst möglich, waren doch sie bisher meist für die Bereitstellung reproduktiver Dienstleistungen im Öffentlichen wie Privaten, das warme Abendessen wie die Sauberkeit im Hotel, zuständig. Im gegenwärtigen Neoliberalismus werde Femonationalismus institutionalisiert, und zwar als Teil der Aufgaben des Staatsapparats, um die soziale Reproduktion zu sichern. Feministische Solidarität müsse weiterhin mit Fokus auf Menschen im Care Sektor gedacht werden, gleichzeitig aber auch die Instrumentalisierungen feministischer Anliegen für rassistische und anti-muslimische Politiken problematisieren.
Die Vorträge von Sara Farri und der darauffolgende von Nikita Dhawan ergänzten einander an einigen Stellen. Besonders deutlich wurde dies bei der wiederholten Benennung der Kölner Silvesternacht als entscheidendem Ereignis für ein Verständnis beschriebener Phänomene. Es wurde deutlich, dass die Bedeutung der Ereignisse und deren darauf folgenden rassistischen Instrumentalisierung für ein feministisches Selbstverständnis bis heute dringlich einer weiteren Analyse bedürfen.
Nikita Dhawan beginnt ihren Vortrag „Die Migrantin retten?! Sexismus, Rassismus und (un)mögliche Solidarität“ mit dem Dilemma, wie risikoreich es sei, über Geschlechtergewalt zu sprechen und wie ebenso risikoreich es sei, nicht darüber zu sprechen. Sie betont, es bedürfe einer kritisch-historischen Analyse von Geschlechtergewalt. Die Rückständigkeit und der Barbarismus der Anderen waren und sind die Folie, vor der sich seit Jahrhunderten ein westliches Selbstverständnis abhebe. Kann über Geschlechtergewalt gesprochen werden, ohne in orientalistische Diskurse zu verfallen, wenn ethnisierte Gruppen weiterhin in kolonialer Manier vereinheitlichend und essenzialisierend als „die XYZ“ beschrieben werden? Pauschalisierende Verurteilungen von heterogenen Gruppen wie „dem Islam“ als frauenverachtend seien gängig aber untragbar.
Sowohl in den Kolonien, als auch auf der anderen Seite – den kolonisierenden Ländern – wurden immer wieder Frauen instrumentalisiert, um Differenz zu markieren. Einerseits stützten sich indigene und koloniale, patriarchale Strukturen. Andererseits wurde indigene Gewalt an Frauen als Legitimation für koloniale Gewalt gewertet. Eine Logik, die sich bis zur vermeintlichen Befreiung von Frauen (qua Entschleierung) durch das Einmarschieren von US-Truppen in Afghanistan nachvollziehen lasse. Dass vermeintliche Geschlechtergerechtigkeit hier einen so zentralen Platz einnimmt, sei nur in einer historischen Entwicklung zu verstehen, galten doch bereits zur Kolonialzeit die Geschlechterbeziehungen der Anderen als das Symbol für deren Rückständigkeit und Barbarismus. Davon könne sich die aufgeklärte, westliche Gesellschaft abheben, in der der weiße Mann weiterhin die zentrale Rolle des „Retters“ innehabe. In antikolonialen Kämpfen, bei denen das Herausbilden einer nationalen Identität zentral war, traten oft Frauen und kulturelle Reinheit als Eigentum des indigenen Mannes, das vor westlichen Eingriffen geschützt werden musste, in den Vordergrund. Eine Fortführung dessen ist das Beispiel einer kürzlich in Indien durchgeführten Verschärfung des Sexualstrafrechts, bei dem Vergewaltigung in der Ehe nicht unter Strafe gestellt wurde, mit der Argumentation, dass dies ein westliches Konzept sei.
Wie können wir also über Gewalt innerhalb von minorisierten und rassifizierten Gruppen sprechen, wenn sich die realen Berichte immer auch mit essentialisierenden kolonialen Diskursen, etwa über „den Islam“, verbinden, so dass dieser als eindimensionale Ursache von Gewalt erscheint? Denn anstatt über Gewalt zu sprechen, folgen auf derartige Berichte meist Forderungen nach Abschiebungen und mehr „Sicherheit“, wie das Kölner Beispiel (2015/16) zeigt. Hilfreich ist dabei der Hinweis auf das Konzept des „hegemonialen Zuhörens“ (Dhawan), das hört, was es hören will, was die eigenen, oft eindimensionalen Bilder bestätigt. Für die abschließende Frage, ob Solidarität zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden möglich ist, sei es demnach unumgänglich, die Zusammenhänge von westlicher Politik und deren Folgen im globalen Süden zu bedenken. Wir dürfen uns nicht als altruistisch verstehen, sondern als Teil des Problems – das setze immer eine Mischung aus Selbstzweifel und Bescheidenheit voraus. Solidarität bringe gleichzeitig nie die Garantie mit sich, etwas „Gutes“ zu tun.
Dass Nikita Dhawans Vortrag durch einen Kommentar im Anschluss als „zu moralisch“ bezeichnet wurde (es gebe ja schließlich Gründe, weshalb die Menschen hier her kommen möchten), löste eine hitzige, für das Thema des Symposiums zentrale Diskussion aus. Die Kritik war wohlgemerkt keine, die Inhalte anzweifelte, sondern eine der davon ausgehenden Moralisierung, die meines Erachtens die Komplexität und Ambivalenz der vorgetragenen Dilemmata nicht ausreichend anerkannte. So kann der Kommentar als Hinweis auf die weiterhin tiefen Konfliktlinien zwischen Menschen, die sich als Feministinnen verstehen, betrachtet werden. „Feminismus ist ein ideologisches Schlachtfeld“, schließt Nikita Dhawan.
Die abschließende Diskussion war von ähnlichen Fragen geprägt. Um sich der unfassbaren, existentiellen Ungleichheit in der heutigen Welt zu nähern, sei es wichtig, dass wir uns als Teil imperialer Lebensweisen (Ulrich Brand) verstehen, so ein Hinweis aus dem Publikum. Dieses Bewusstsein der eigenen Verstricktheit dürfe jedoch nicht handlungsunfähig und immun machen. „Reflecting the self and moving away from the I“, fordert ein Diskussionsbeitrag.
Was denn nun eigentlich das Thema des heutigen Feminismus sei, war die letzte Frage aus dem Publikum. Deren Beantwortung wurde als Aufgabe folgender Beschäftigungen festgehalten. Ob dies unter anderem an der Uni Wuppertal mit der inzwischen einschlägigen feministischen Ausrichtung von Teilen der Bildungswissenschaft passieren wird, bleibt zu hoffen. Fest steht: Es gibt nicht den einen Feminismus, sondern nur eine Pluralität verschiedener Ansätze im Kampf für Geschlechtergerechtigkeit und auch, wer diejenigen sind, die Solidarität brauchen, wandelt sich.
Was bleibt nun von der „Schwesterlichkeit“ nach diesem kontroversen und ergiebigen Tag? Es wurde nicht endgültig als Fazit benannt, doch scheint mir deutlich geworden zu sein, dass der Begriff der Schwesterlichkeit auf der Suche nach feministischer Solidarität keine abschließende Lösung sein kann. Der Vortrag von Barbara Rendtorff antwortete auf diese Frage am klarsten, indem sie den Begriff problematisierte. Elisabeth Schäfer spielte vereinzelt damit, ging ihm aber größtenteils aus dem Weg. Sara Farris und Nikita Dhawan antworteten indirekt – indem sie den Begriff Schwesterlichkeit ausließen, dafür aber zahlreiche Beispiele für die Herausforderungen und Notwendigkeiten von (feministischer) Solidarität darstellten.
Mir scheint, als rufe aus dem von den Veranstalterinnen gewählten Begriff der Schwesterlichkeit eine Sehnsucht nach feministischer Kollektivbildung, nach Gemeinschaft und (wenn auch nicht immer einträchtiger) Einheit im Kampf für die gemeinsame Sache. Dieser nachvollziehbare Wunsch ist vielerorts spürbar und eine Gemeinschaft von Menschen, die sich als Frauen verstehen, aber genauso auch gender-diverse Kollektive können eine wichtige Grundlagen feministischer Solidarität sein. Es damit gleichzusetzen, das hat das Symposium gezeigt, wäre dennoch fatal.
Drei Fragen an das Kollektiv Ismigone Komplex
Was versteht ihr unter Schwesterlichkeit im Rahmen des Symposions?
Ismigone Komplex: Zuerst lässt sich sagen, dass wir diese Schwesterlichkeit weder biologisch noch essentialistisch meinen. Das Symposion verhandelte die Frage, wie sich auf den neoliberalen Nihilismus antworten lässt, indem es sich auf die Suche begab, nach einem Verbindenden, das keine Identität, keine geschlossene Synthese meint. Die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts zeigt dabei die Schwierigkeit dieses Unterfangens an, da damit keine volksgemeinschaftliche oder naturverbundene Solidarität gemeint sein kann. Schwesterlichkeit ist somit für uns eine fortwährende Aufgabe.
Könnt ihr für euch schon ein Ergebnis formulieren? Was wäre das?
Ismigone Komplex: Die Veranstaltung hat gezeigt, dass es nicht so einfach ist, den Begriff der Schwesterlichkeit positiv zu formulieren. Alle Vortragenden haben diesen ex negativo, durch das, was er eben nicht ist, bestimmt oder den Begriff der Schwesterlichkeit dekonstruiert. Festhalten lässt sich jedoch, dass Schwesterlichkeit in einer ambivalenten Verbindung zur Solidarität steht, die man auch mit der Ambivalenz zwischen Persönlichem und Politischem übersetzen könnte. Unser Anliegen war es, eben diese Verbindung nicht als eine sich gegenüber stehende zu begreifen, sondern eine Verbindung der beiden Begriffe zu suchen. Jedoch reicht es nicht, wenn alle Frauen Schwestern werden. Genauso wenig wie es gereicht hat, dass alle Männer Brüder wurden. Für uns stellt sich also die Frage nach der Vermittlung, welche keine herrschaftliche ist. Darüber, was gemeinsame Ziele sein könnten, müsste weiter reflektiert werden.
Was wird nun aus dem Ismigone Komplex?
Ismigone Komplex: Ismigone Komplex begann als ein feministisch-studentisches Kollektiv. Wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit, d em Überschuss eine Dauer zu verleihen.
Kontakt: ismigonekomplex@mail.de
[1] An späterer Stelle werden für innerfeministische Auseinandersetzungen mit Differenz weitere Beispiele genannt, etwa die Diskussionen um Antisemitismus im Feminismus, aber auch die theoretischen und aktivistischen Beiträge von FeMigra, Sedef Gümen und zahlreichen anderen.

Ein Kommentar
Guten Abend, nur ein kleiner Hinweis: Der link, der an den Namen „Elisabeth Schäfer“ gehängt ist, führt zu einer anderen Person mit ähnlichem Namen. Die Elisabeth Schäfer, die in Wuppertal vorgetragen hat, ist an der Uni Wien zu finden.
Schöne Grüße
Barbara Rendtorff