von Anna Seidel
Pünktlich zum Frauenfilmfestival in Dortmund kreisen unsere Gedanken vor allem um die Ladies im Film- und Fernsehbusiness. Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Anna Seidel (WWU Münster) forscht immer mal wieder dazu. Im Sommer erscheint zum Beispiel ihr Aufsatz zu Popfeminismus und Fernsehen und gerade arbeitet sie gemeinsam mit Anne Lippke an einem Aufsatz zu Lena Dunhams Produktionen Tiny Furniture und Girls. In diesem Zusammenhang ist sie auch auf John Alberti gestoßen, einen Professor für Cinema Studies an der Northern Kentucky University. Lest, wie die beiden über Film, Fernsehen und Feminismus reden:
John, in Forschung und Lehre widmen Sie sich vor allen Dingen popkulturellen Phänomenen, wie Games und Filmen, was ich gut finde – ich mache es auch so. Wenn Sie nun jemand fragt, warum Sie gegenwärtige Phänomene, wie die Simpsons und Facebook erforschen, anstatt eher klassische, wie den Kaufmann von Venedig oder frühe Briefromane, was antworten Sie?
Ich habe darauf zwei Antworten. Zum einen sehe ich dieses ‚anstatt’ nicht. Ich denke nicht, dass Popkulturforschung ausschließt, sich mit älterer, eher kanonischer Literatur auseinanderzusetzten, oder umgekehrt. Ich habe über die Simpsons und Facebook geschrieben und ich habe über Mark Twain und Henry James geschrieben. Ich sehe all diese Gegenstände als komplexe kulturelle Texte. Zum anderen waren – und das hängt mit dem ersten Teil meiner Antwort zusammen – Texte wie Der Kaufmann von Venedig oder ein Briefroman aus dem 18. Jahrhundert Teil der ‚Popkultur’ ihrer Zeit. Der Begriff und die Idee von ‚Popkultur’ entwickelt sich erst im späten 19. Jahrhundert, als unsere derzeitigen Modelle von ‚high’, ‚middle’ und ‚low’ culture als Teil eines bourgeoisen Gedanken etabliert wurden. Es ist also ein wenig anachronistisch, den Kaufmann von Venedig als popkulturell zu beschreiben. Allerdings kann man ja schon sagen, dass Shakespeare mit einer gewissen Pop-Sensibilität geschrieben hat. Er schrieb für alle möglichen Bildungsschichten und hatte ein viel breiteres Publikum, als es die Schreiber_innen der Simpsons bedienen.
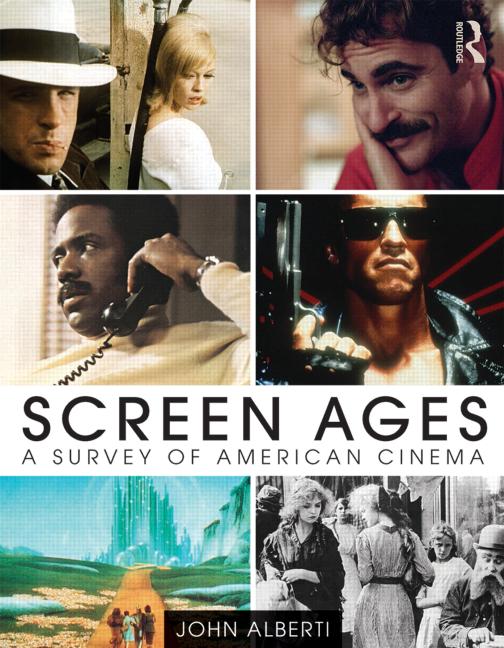
Ich bin bei der Recherche für einen Aufsatz zu Lena Dunhams Film Tiny Furniture und ihre Serie Girls auf Ihre Arbeit gestoßen. In Ihrem Lehrbuch Screen Ages: A Survey of American Cinema beschreiben Sie Dunham als ein Indie-Fräuleinwunder („girl wonder”). Was macht ihre Arbeit so herausragend im gegenwärtigen Kino und Fernsehen?
Es gibt viele Gründe, aber voranstellen würde ich vor allem, wie beispielhaft ihre Karriere durch digitale Technologie die erweiterten Möglichkeiten zur Partizipation und für Zugang repräsentiert. Die traditionellen Gatekeeper-Strukturen der analogen Kultur – Regisseure, Produzenten, media executives – die es jungen Leuten, und vor allem jungen Frauen, ursprünglich erschwert haben, zentrale künstlerische Positionen einzunehmen und wahrgenommen zu werden, wurden geschwächt. Noch eine Generation früher wäre es für Dunham weitaus schwieriger gewesen, ihren Debütfilm zu finanzieren und zu produzieren; vom Vertrieb ganz zu schweigen. 2010 konnte sie ein Publikum für ihren Film finden und bekam direkt ein Angebot von HBO – all das in ihren Mittzwanzigern.
In diesem Zusammenhang kann man auch die junge Journalistin/Schauspielerin Tavi Gevinson erwähnen, die sich erst mit nur elf Jahren einen Namen als Fashionbloggerin gemacht hat, bevor sie das Rookie Zine gegründet hat. Offensichtlich sind diese beiden Beispiele, Lena Dunham und Tavi Gevinson, immer noch Ausnahmen, aber die Möglichkeiten für junge Künstlerinnen erweitern sich permanent.
Girls wurde dafür kritisiert, ein Film von privilegierten Frauen in New York über privilegierte Frauen in New York zu sein. Diversität sucht man innerhalb der Serie (fast) vergeblich. In Ihrem kurzen Kapitel zu Dunham machen Sie deutlich, dass Girls trotzdem ein Schritt nach vorn bedeutet im Vergleich zum sonstigen Film- und TV-Business. Warum ist das so?
Ganz einfach, weil im Hauptprogramm eine Serie über das Leben junger Frauen produziert von einer jungen Frau für sich genommen schon eine revolutionäre Entwicklung ist. Es gibt buchstäblich keinen Vorläufer, kein Beispiel dafür vor Girls. Die Kritik an der mangelnden Diversität in der Serie ich berechtigt (und die Serie hat selbst darauf reagiert), aber ich würde einwenden, dass Girls den Weg für weitere Produktionen ebnet – und zwar solche, die eine ganze Bandbreite an kulturellen Erfahrungen repräsentieren – und dass man von einer einzigen Sendung nicht verlangen kann, dass sie alles für alle sinnvoll aufbereitet.
Dunham schreibt aus ihrer eigenen Perspektive heraus und verarbeitet eigene Erfahrungen, die selbstverständlich mit ihrem eigenen demographischen Hintergrund verknüpft sind. Abgesehen davon ist es natürlich kein Zufall, dass HBO sich entschieden hat, wenn sie schon eine Serie über das Leben junger Frauen machen, mit einer Serie über junge, gut situierte, weiße Frauen zu beginnen. Aber ich hoffe, dass Girls nicht die letzte Serie von einer jungen Frau über junge Frauen im premium cable TV bleibt.
Auf mich wirkt Girls wie eine besonders gut vernetzte TV-Produktion, die Online-Angebote, wie etwa Instagram, Twitter, YouTube neben der Fernsehausstrahlung als Kanäle für sich nutzt. Die Serienmacher_innen machen sich damit die Vorteile dessen zunutze, was die Cultural-Studies-Denker_innen Paul Du Gay et al. als „Circuit of Culture” beschrieben haben: Bedeutung wird nicht nur von Dunham und ihrem Team produziert, sondern zum Beispiel auch vom Publikum und davon, wie es Girls ‚nutzt’. Die Kritik der Zuschauer_innen kommt über die Sozialen Medien und es wirkt, als würde sie auch produktionsseitig wahrgenommen. Wie unterscheidet sich dieses Feedback Ihrer Meinung nach von eher klassischen Film- und Fernsehbesprechungen?
Da möchte ich nochmal auf die Beobachtung der Schwächung der traditionallen Gatekeeper-Kultur verweisen, die ich eben schon erwähnt hatte. ‚Offizielle’ Rezensent_innen der herrschenden Medien fungierten in der prädigitalen Ära eben als Gatekeeper für das Feedback zwischen Produzent_innen und Konsument_innen. Mit den neueren Entwicklungen wird die gesamte Unterscheidung zwischen Produzent_innen und Konsument_innen in Frage gestellt, ein Prozess der sich auch im noch recht neuen Begriff ‚Prosumer’ und dem zugehörigen Konzept der Convergence Culture bei Henry Jenkins findet.
Eine zentrale Frage hat mit dem Drang der Medien- und Internetkonzerne zu tun, diesen ‚Circuit of Culture’ auszubeuten und zu Geld zu machen. Die Gatekeeper haben innerhalb kapitalistischer Ästhetiken immer gleichzeitig eine kulturelle und eine ökonomische Rolle, indem sie mit ihrem ästhetischen Urteil und ihrer redaktionellen Vorauswahl für eine Angebotsknappheit sorgen, die die kommerzielle Ausbeutung von Kultur begünstigt. Der Circuit of Culture gefährdet dieses ökonomische Modell und die Verfahren des modernen Kapitalismus passen sich in ihrem Versuch, die Kontrolle zurückzugewinnen schnell an.
Es ist unbestritten, dass die Film- und Fernsehindustrie, sowohl in den USA, als auch in Deutschland, immer noch von Männern dominiert wird. Klar, es gibt einige Frauen, die erfolgreich sind, aber die Branche ist weit entfernt davon, Männern und Frauen gleiche Chancen zu ermöglichen. Wie können die Indie-Produktionen, die Sie ja auch in Screen Ages diskutieren, dabei helfen, Gleichberechtigung in Film und Fernsehen zu erreichen?
Das ist eine sehr weitreichende Frage! Es gibt viele Wege, dieses Thema anzugehen; Ich bin zur Zeit besonders daran interessiert daran, wie die kulturellen und materiellen Praktiken in der Film- und Fernsehproduktion sich verändern müssen, um sowohl unsere Definition dessen, was es bedeutet, einen Film zu machen zu verändern, als auch davon, wer diese Macher_innenposition besetzt. Ich denke, das traditionelle und konfliktreiche Modell einer Führerschaft in der der Regisseur als eine Art General oder Diktator auftritt und eine Armee-mäßige Crew kommandiert, repräsentiert eine gegenderte kulturelle Formation, die die Vielfalt kultureller Ästhetiken und Gegenstände des Kinos einschränkt. Das ist eine Einschränkung, die konsequent gegen Filmemacherinnen arbeitet. Dieses Thema werde ich im bald erscheinenden Essay intensiver besprechen. Der Band mit dem Titel Indie Reframed wird, so hoffe ich jedenfalls, im Laufe des Jahres erscheinen. In der Zwischenzeit gibt es eine kürzere Version meiner Überlegungen in meinem Konferenzbeitrag, der auf einem Interview mit der Indie-Regisseurin Lynn Shelton beruht: „The Director as Facilitator: Collaboration, Cooperation, and the Gender Politics of the Set.” Den Beitrag kann man sich hier ansehen:
Zur Zeit wird in Deutschland eine Quote diskutiert, die gewährleisten soll, dass Regisseurinnen genau so viele Fördergelder erhalten, wie Männer, was zur Zeit nicht der Fall ist. Was denken Sie über diese politischen Interventionen, die auf Gleichstellung hinauslaufen sollen?
Ich würde meinen, dass diese Maßnahmen notwendig, aber nicht ausreichend sind. Hier, in den Vereinigten Staaten, wo es nur wenige öffentliche Fördermittel für die Künste gibt, klammern sich viele der Programme an das Konzept des ‚blind judgement’ (eine Bewertung des Projekts ohne das Wissen um das Gendering der einreichenden Person, AS). Die Entscheidung, welche Arbeit unterstützt werden soll, basiert dann einzig und allein auf den objektiven ‚ästhetischen’ Werten der Bewerber_innen. Aber für meine Begriffe ist deutlich, dass diese Prozesse einem Gender-Bias folgen, wenn regelmäßig mehr Männer als Frauen gefördert werden. Das ist anscheinend auch in Deutschland der Fall. Ich denke, es ist ethisch notwendig und politisch unerlässlich, Maßnahmen wie eine Quotierung zu ergreifen, um dem eingewurzelten Bias entgegenzuwirken.
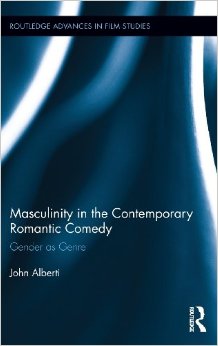
Sie forschen nicht nur zu weiblichen Filmemacherinnen und deren Arbeit, Sie untersuchen auch Repräsentationen von Gender im Film. Stichworte Ihrer Arbeit wären „Bromance” und Männlichkeit in der Gegenwarts-RomCom. Sind die Filme, die Sie da untersuchen, ein Spiegel der Gesellschaft, oder ist da irgendwie mehr?
Das Hauptproblem der ‚Spiegel’-Analogie ist, dass sie voraussetzt, dass sich Kunst und Gesellschaft in zwei getrennten Sphären befinden, dass wir Filme auf der einen und Gesellschaft auf der anderen Seite haben. Kulturelle Texte – Filme, Fernsehen, Musik, Literatur, Werbung etc. – sind, so sehe ich es, untrennbar mit den stattfindenden kulturellen Entwicklungen verbunden, die definieren zum Beispiel mit, welche Bedeutung wir Gender und Sexualität geben.
Der Neologismus ‚Bromance’ ist da ein gutes Beispiel. Er entwickelte sich zur gleichen Zeit in der sogenannten real world als Beschreibung für die Beziehung zwischen heterosexuellen Männern, wie er auch in der typischen zeitgenössischen RomCom auftauchte. Die Filme reflektieren, wenn wir an diesem Begriff festhalten wollen, was in der Gesellschaft passiert. Aber während sie reflektieren, definieren und ändern sie gleichzeitig die Bedeutung des Begriffs. Anders: Es gibt keine Ablage, in der wir abstrakte Konzepte von Gender und Sexualität lagern. Diese Konzepte existieren nur in Form spezifischer kultureller Texte und in den Formen kulturellen Ausdrucks.
Eine letzte Frage: In diesem Semester unterrichten Sie einen Kurs zu Riot Grrrls – vermutlich eines meiner Lieblingsthemen. Was ist Ihre liebste filmische Verhandlung mit Riot Grrrls? Meine ist wahrscheinlich eine Roseanne-Folge.
Die Roseanne-Folge ist wirklich ziemlich gut! Komischerweise gibt es gar nicht so viele Filme, die die Riot-Grrrl-Bewegung so direkt verhandeln. Der Indiefilm All About Me von 1997 ist eine schöne Ausnahme. Ich mag auch die Bikini-Kill-Referenz in Zehn Dinge, die ich an Dir hasse.
Ein aktueller schwedischer Film, der, wie ich finde, den Riot-Grrrl-Spirit einfängt, ist We Are The Best (obwohl der Film zehn Jahre und einen Kontinent entfernt von Riot Grrrl spielt)!

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, John!
John Alberti auf Twitter: @jalberti
Anna Seidel auf Twitter: @_AnnaSeidel
