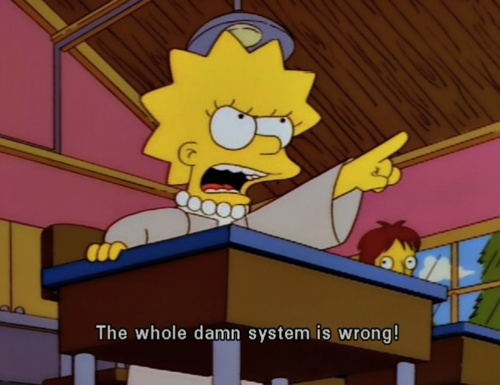von Nadine Dannenberg
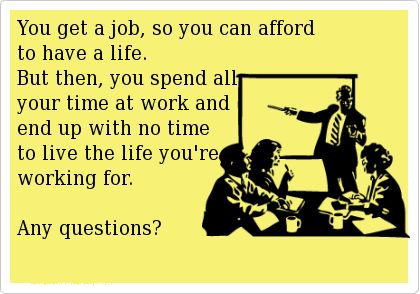
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedeutet nicht dasselbe wie Vereinbarkeit von Familie und Karriere. Das Ersteres möglich ist haben Generationen von Working-Class-Familien bewiesen und kriegen es nach wie vor hin irgendwie alles zu managen, ohne Zweifel jedoch mit viel Aufwand und unter Aufbringung aller zur Verfügung stehenden Ressourcen.
Verzwickt wird es jedoch beim zweiten, und das liegt in erster Linie an nach wie vor dominierenden androzentrischen Konzepten von Familie und Karriere.
Vor einigen Tagen erschien an dieser Stelle ein Interview mit Professorin Katja Sabisch zu selbigem Thema, in welchem sie das komplexe Spannungsverhältnis von Mutterschaft und Wissenschaftlerinnen-Dasein beleuchtete und dabei einige sehr wichtige Punkte ansprach. In einer Welt, in der sich die *Normalbiografie* noch immer an einem archaischen Modell vom männlichen Vollzeitarbeiter und seiner weiblichen Hausfrau im Hintergrund orientiert, ist es insbesondere für Mütter nach wie vor nahezu unmöglich Karriere und Familie gleichzeitig zufriedenstellend zu verwirklichen. Wobei sich jedoch die Frage stellt von wessen Zufriedenheit hier eigentlich gesprochen wird – der eigenen oder der systemischen? Und genau das ist der Punkt, an dem wir uns alle, die wir in dieser Welt irgendwie gescheit existieren wollen, über Begriffe und Vorstellungen der Lebensgestaltung unterhalten müssen. Denn die derzeit vorherrschenden Strukturen sind nicht nur für Mütter Gift, sondern für viele andere Menschen auch.
In diesem Kontext lautet das Stichwort Reproduktionsarbeit. Reproduktion heißt Zukunftsorientierung, und damit auch Regeneration. Das bedeutet nicht nur Kinder in die Welt zu setzen und aufzuziehen, damit eine unvorhersehbare Zukunft imaginiert werden kann, sondern auch die eigene Arbeitskraft für zukünftige Zeiten zu erhalten. Die Arbeitszeit endet auch für mich als Single nicht wenn ich die Bürotür hinter mir zumache, sondern setzt sich fort übers Einkaufen, Putzen, soziale Beziehungen pflegen und stellt letztlich somit alles, was ich in meiner *Freizeit* tue in den Dienst einer reproduktiven Arbeitskraft. Das gilt umso mehr, wie Sabisch im Interview zu Recht anmerkte, für Wissenschaffende, die mit allzeitiger Einsatzbereitschaft ihr ganzes Dasein dem Prozess des Wissenschaffens widmen sollen. Ich gehe nicht einfach nur in eine Kunstaustellung um mir einen schönen Tag zu machen, sondern bin immer auf der Suche nach möglichen neuen Forschungsfeldern und Kooperationspartnerschaften. Oder zumindest muss ich meinen *freien* Arbeitstag in dieser Art und Weise legitimieren. Im Sinne des solidarischen Miteinanders habe ich als Single zudem in meinem Anspruch auf „Freizeit“ zugunsten all jener zurückzustecken, die ein irgendwie institutionell anerkanntes Familiengefüge aufweisen können. Kinder bieten da immer noch die beste Entschuldigung, doch schon bei der Betreuung von Eltern stößt eins mitunter auf weniger Verständnis. Von nicht-heterosexuellen Partnerschaften, oder schlicht und ergreifend Freundschaften ganz zu schweigen.
„So etwas wie Fruchtbarkeit, Reproduktion und soziale Beziehungen werden ganz oft aus der Wissenschaft rausgehalten.“ merkt Sabisch an einer Stelle an, und trifft damit den Kern einer Debatte derer sich insbesondere eine nach wie vor marginalisierte queer theory angenommen hat, jedoch damit in der Tat kaum Gehör in institutionalisierten Wissenscommunities findet. Dabei geht es hierbei um essentielle Fragen, die für jede_n einzelne_n Wissenschaffende_n von Bedeutung sind, nämlich: wie wollen wir leben und welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein?
Und damit komme ich zum zweiten Begriff der Karriere, der unausweichlich mit einer Lebensideologie verbunden ist in deren Mittelpunkt eine ganz bestimmte Idee von re- produktiver Arbeit steht und diese Idee ist – was sonst?! – kapitalistisch. Wie schon genannt sieht die Otto-Normal-Biografie noch immer einen idealen Lebensentwurf vor, der sich am historisch gewachsenen Bild des männlichen Otto orientiert. Das heißt kompromisslose Aufopferungsbereitschaft und uneingeschränkte Freude für und am Lohnberuf, bei dem am Ende irgendein zielorientiertes, für den Markt verwertbares Produkt herauskommen soll. Otto arbeitet gerne und immer, und wenn er Karriere machen will sogar noch ein bisschen besser und mehr. Dieser androzentrischen Weltsicht hat sich in gewaltvollem Ausmaße alles andere zu unterwerfen. Wer nicht bereitet ist 24/7 erreichbar und einsatzbereit zu sein, „will es halt nicht wirklich“. Das neoliberale Versprechen trichtert den Menschen von kleinauf ein dass sie alles – vor allem eine Karriere – erreichen können, wenn sie nur bereit sind hart genug dafür zu arbeiten. Psychisch-emotionale Bedürfnisse, oder überhaupt individuelle Lebensentwürfe, fernab einer leistungsorientierten Kapitallogik sind in dieser Ideologie einer permanenten Selbstoptimierung zugunsten der Systemoptimierung nicht vorgesehen. Darunter leiden nicht nur – aber in besonderem Ausmaß – Mütter, sondern alle die noch Träume haben. Und zwar vor allem solche, in denen Gleichberechtigung auch über ein binäres Geschlechterdenken hinaus eine zentrale Rolle spielt.
Denn danach zu fragen, was sich ändern muss, damit Mutterschaft und Karriere einander nicht ausschließen, ist schön und gut und freilich auch wichtig, für all jene die danach streben. Doch was ist mit all den anderen, die keine Mütter sind, sein können und/oder sein wollen? Was mit jenen, die die Bedingungen des derzeitigen Karriereverständnisses nicht erfüllen können und/oder wollen? Und ganz banal: was ist mit mir und meinen ureigenen Vorstellungen von einem guten Leben? Ist denn eine „Normalbiografie“, egal ob weiblich, männlich, inter* oder sonstiges, wirklich die einzige Lebensperspektive?
Letztlich lässt sich aus einer feministischen Perspektive die alte Frage stellen, ob das Streben und Einnisten in Konzepten, die ganz klar heteronormativ und androzentrisch geprägt sind, tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg ist, oder ob wir nicht vielmehr Vorstellungen von Familie und Karriere an sich angreifen und zum Abschuss freigeben müssen. Denn am Ende des Tages ist es doch genau dieses Streben nach einer „Normalbiografie“ – die Vorstellung es gäbe eine wie auch immer geartete „Normalität“, eine Norm an der sich alle Menschen ausrichten ließen – das was uns alle irgendwann irgendwie irgendwo an die Grenzen des Machbaren treibt und uns darüber verzweifeln lässt.