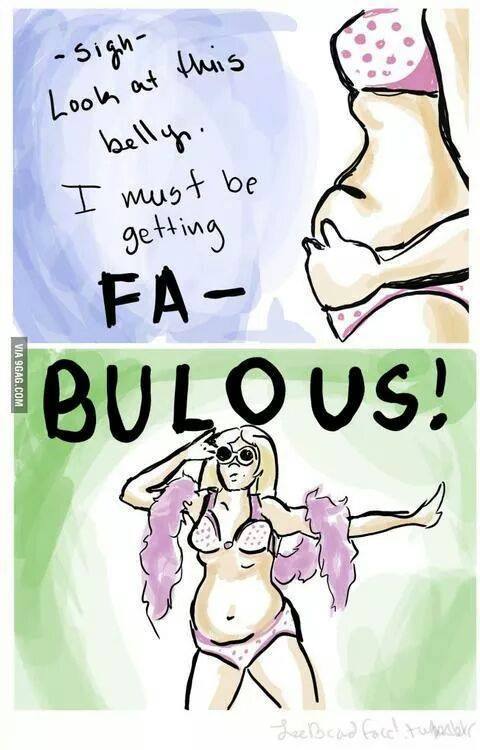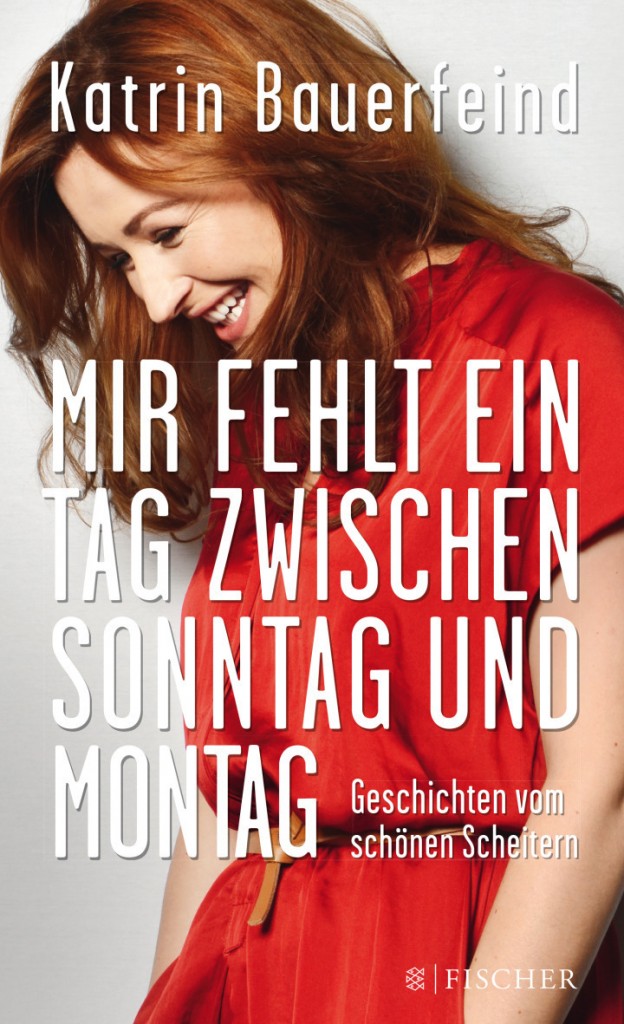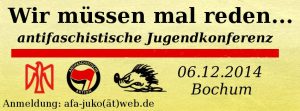von Fließbandbaby
Neulich habe ich auf der Internetseite des Deutschlandradios eine Buchbesprechung gelesen.Es ging um das neue Werk von Beatrice von Weizsäcker mit dem Titel „JesusMaria. Christentum für Frauen“. Was ich gelesen habe, hat mich gestört. Gleich zu Anfang: Gemeint ist nicht das ganze Buch, sondern nur das Vorwort – es handelt sich hier entsprechend nicht um eine Rezension, sondern nur um eine Auseinandersetzung mit den Aspekten, die von Weizsäcker in ihrem Vorwort für erwähnenswert gehalten hat. Gestört gefühlt habe ich mich auf zwei Ebenen: Als Mensch, biologisch eine Frau, an Genderfragen interessiert und in seiner diesbezüglichen Selbstwahrnehmung sehr offen ist. Auf zweiter Ebene als Studentin der evangelischen Theologie.
Was stört mich konkret als gendersensibles, biologisch weibliches und praktizierend evangelisches Wesen?
Mich stört, dass von Weizsäcker Geschlechterklischees vergangener Generationen erneut als selbstverständliche Gegebenheiten proklamiert: „Frauen sind in der Regel barmherziger als Männer.“ „Frauen sind friedfertiger als Männer […] Das liegt auch daran, dass sie nicht so skrupellos sind wie viele Männer.“ Identifiziert werden diese Eigenschaften mit denen, die von Weizsäcker Jesus von Nazareth zuschreibt: „Es sind auch weibliche Tugenden, die Jesus ausmachten, nicht nur Männliche. Ihn trugen Glaube, Hoffnung und Liebe. Auch diese drei werden in der Regel nicht mit Männern verbunden, sondern mit Frauen.“ „Der Blick auf sein Leben, auf das, was er verkündete und tat, ist Frauen oft näher als Männern. Leidensfähigkeit, Mitleiden, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Dienst am Menschen: All das ist eher typisch für Frauen als für Männer.“
Hier setzt die zweite Ebene meiner Verärgerung ein. Zurzeit belege ich ein Seminar zu Forschungsperspektiven auf das Leben Jesu und erfahre einmal mehr, wie komplex und oft spekulativ diese Forschung ist. Von Aussagen wie „Jesus hätte das nicht gewollt“ oder „Jesus war so und so“ sollte jede*r mit gesundem Menschenverstand absehen – denn was Jesus genau gesagt und gemacht hat, wissen wir schlichtweg nicht. Natürlich, es gibt die Evangelien, die neutestamentlichen Briefe und außerbiblische Quellen, die wir zur Rekonstruktion des Lebens Jesu heranziehen können, aber diese Texte wurden von Menschen geschrieben. Sie sind vieles, aber eins sind sie nicht: historisch zuverlässige Handlungsberichte. Man kann nicht wie von Weizsäcker davon ausgehen, dass, was „nach der Bibel verbrieft“ ist, auch tatsächlich so war. Das ist in der Theologie nicht erst seit gestern common sense, sondern seit über 100 Jahren. Um das zu verstehen, muss man im Übrigen auch nicht Theologie studieren – dass die Lebensgeschichten Jesu in den vier Evangelien oder die beiden Schöpfungsberichte in der Genesis unterschiedlich sind, merkt selbst ein Kind.
Es ist einerseits gewinnbringend und wichtig, dass auch „Laien“ über Glaube und Religion schreiben – zumal bei Protestanten das Priestertum aller Gläubigen gilt. Es ist andererseits frustrierend, wenn diese Laien dann ihre eigene Bibelinterpretation und ihr persönliches Glaubensempfinden als Gottes/Jesu Willen verkünden. Persönlicher Glaube ist eine Ebene, auf der es kein Richtig und Falsch gibt. Aber Theologie ist eine Wissenschaft und als solche hat sie Methoden, die es zu wahren gilt, wenn man etwas mit dem Anspruch auf Richtigkeit von sich gibt. Von Weizsäcker ist promovierte Juristin, es ist davon auszugehen, dass sie um die Richtlinien wissenschaftlicher Arbeit weiß. Warum verweigert sie Wissenschaftlichkeit bei einem Thema, das sie doch so dringend nötig hat? Nicht zuletzt stört mich ein Seitenhieb auf die feministische Theologie: Was die denn nütze, wenn sie Männer ausschließe, fragt die Autorin. Auch hier hätte ein Fitzelchen mehr Wissenschaft nicht geschadet.